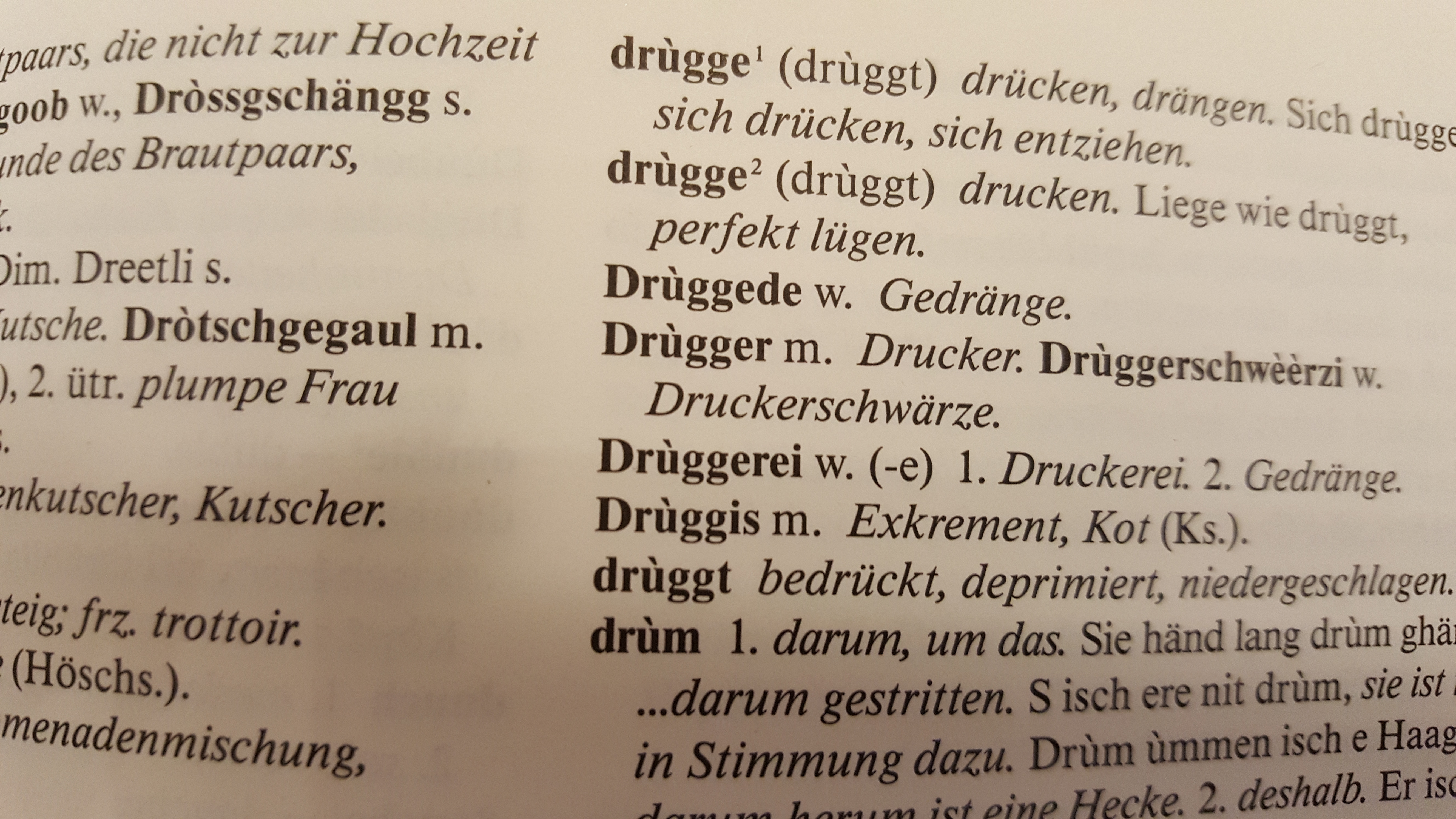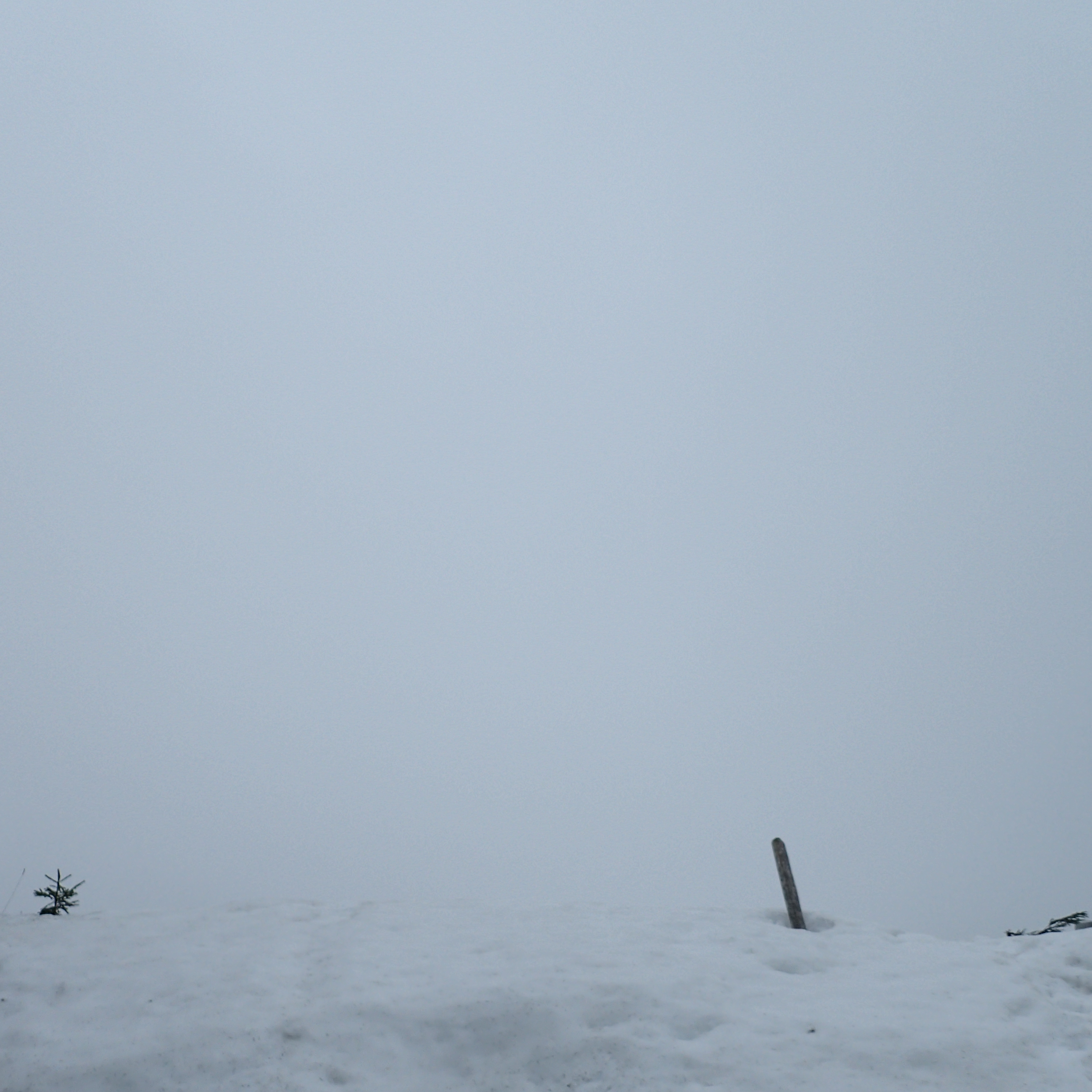„I asked the famously effective satiric draftsman Saul Steinberg if he was gifted. He said he was not, but that the appeal of many graphic works of art was the evident struggle of their creators with their obvious limitations. Put another way by me: We like some works by some artists who couldn’t do what Michelangelo could do, but who damn well made pictures anyway.
I asked many people more committed than I am to the making of pictures by hand when it was that their art gave them the most satisfaction. When it was framed and exhibited? When it was published or sold? When it was praised by loved ones or an important critic? When? Three of those I asked were my own daughters Edith and Nanette, and my son Mark. Few I asked were world renown.
All replied without hesitation that they were most at one with the universe when making a picture in perfect solitude. All the rest was by comparison annoying balderdash. I say that, too. And let me add that the pictures in this catalog are the works of two persons, myself and the silk-screen virtuoso Joe Petro III of Lexington, Kentucky, each of us working alone, and experiencing from time to time almost indecent ecstasy.“ (Kurt Vonnegut)
Ich mag Vonnegut, den Schriftsteller, sehr und kann auch Vonnegut, den Zeichner, gut leiden, darum werde ich mir das Zitat eines Tages als Druck kaufen und an die Wand hängen.
Aber so sehr mich das Bild vom mit sich selbst zufriedenen Vonnegut auch erwärmt: Inhaltlich zustimmen kann ich ihm leider nicht.
Für mich ist es nämlich keineswegs das Größte, einsam vor mich hinzuarbeiten. Für mich kommt das Größte erst danach. Das Größte am Schreiben ist es für mich, wenn ich einen Text von mindestens 20 Seiten Länge fertig habe und diesen Text ausdrucke.
Großartig ist dieser Moment aus verschiedenen Gründen. Sie hängen alle mit meinem Drucker zusammen:
- Erstens braucht mein Drucker so lange, um den Raum mit diesem einzigartigen Duft zu füllen. Vielleicht kennen Sie den Duft, den ich meine? Wäre ich Parfümeur, ich würde Flakons gefüllt mit der von meinem Drucker verströmtem Luft verkaufen. „Heureka“ würde ich den Duft nennen oder „Es ist vollbracht!“ und alle (die so sind wie ich) würden es kaufen und wären endlich zufrieden.
- Zweitens legt mein Drucker zwar Blatt auf Blatt, aber ein schöner Stapel wird daraus noch nicht. Aus 20 Blatt Papier einen schönen Stapel zu formen, das erfordert menschliches Zutun. Den Stapel erst durch mehrfaches Auf-Die-Tischplatte-Klopfen an seinem kurzen Ende bündig machen, die Prozedur dann am langen Ende wiederholen und die Bögen, wenn das sachte Klopfen nicht reicht, durch Aufwölben gefügig machen: So erfüllend, denke ich mir dann immer, muss sich echte Handarbeit anfühlen.
- Drittens ist das Papier, wenn es frisch mit meinen Gedanken bedruckt und sauber gestapelt vor mir liegt, noch warm. D
as ist der Grund, warum ich, bevor ich mich ans Ausdrucken mache, immer die Vorhänge zuziehe, denn den noch warmen Stapel Papier schiebe ich mir nun unters Hemd und das, Sie ahnen es, ist dann der Zeitpunkt, an dem ich das erlebe, was Vonnegut mit „almost indecent ectasy“ umschreibt.
Um diesen Moment erleben zu dürfen, schreibe ich und meinetwegen könnte es damit vorbei sein, beziehungsweise von vorne anfangen.
Aber man ist ja keine Insel. Man soll ja ein Publikum finden. Man ist ja gefordert, aus einem Manuskript ein Buch werden zu lassen.
Darum beginnt jetzt, wo das Manuskript fertig ist (zumindest ein erster Entwurf, der in Wirklichkeit der elfte Entwurf ist, aber der erste, für den ich mich nicht schäme), ein ganz anderer Abschnitt in meinem Schaffen. Darin dreht sich alles um eine Frage: Wird daraus ein Buch?